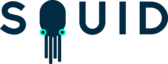Berlin (Reuters) – Das Defizit im deutschen Staatshaushalt ist im vergangenen Jahr größer ausgefallen als bislang angenommen.
Die Ausgaben von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherung überstiegen die Einnahmen um 87,4 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Eine erste Schätzung im Januar hatte nur ein Minus von 82,7 Milliarden Euro ergeben. “Das Defizit blieb damit hoch”, betonten die Statistiker. Es fiel allerdings um 9,5 Milliarden Euro geringer aus als 2022 – auch weil Ausgaben zur Bekämpfung der Corona-Pandemie größtenteils entfielen, etwa für Test und Impfstoffe. Das neue Ergebnis entspricht einer Defizitquote von 2,1 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, die damit erneut unter der EU-Obergrenze von drei Prozent blieb. 2022 lag sie noch bei 2,5 Prozent.
Grund für den Rückgang: Die Einnahmen des Staates stiegen mit 4,4 Prozent auf 1901,8 Milliarden Euro stärker als die Ausgaben, die um 3,7 Prozent auf 1989,2 Milliarden Euro zulegten. Wegen der Rekordbeschäftigung nahm das Aufkommen aus den Sozialbeiträgen um 6,6 Prozent zu. Die Steuereinnahmen wuchsen dagegen lediglich um 0,7 Prozent. “Dies lag neben der schwachen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auch an umfangreichen Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft”, hieß es. Hierzu zählten unter anderem Entlastungen durch das Inflationsausgleichsgesetz, die Senkung des Umsatzsteuersatzes bei Gas von 19 auf sieben Prozent, die Verlängerung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes bei Speisen in der Gastronomie bis Ende 2023 und die steuerfreien Inflationsausgleichsprämien. Die Zinsausgaben des Staates kletterten infolge gestiegener Leitzinsen um 36,2 Prozent.
NUR SOZIALVERSICHERUNG IM PLUS
“Die Defizitzahlen zeigen, wie verfehlt aktuelle Debatten über ein vermeintliches Aufblähen der Ausgaben und akuter Haushaltsprobleme aus ökonomischer Sicht sind”, sagte der wissenschaftliche Direktor des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien. “Der Fehlbetrag lag trotz krisenbedingter Mehrausgaben etwa für die Energiepreisbremsen deutlich unter jenem der Jahre 2020 und 2021.” Die Beschränkungen der Schuldenbremse erschwerten derzeit massiv eine angemessene politische Reaktion auf die schwierige wirtschaftliche Lage.
Die Neuverschuldung geht vor allem auf das Konto des Bundes, der ein Finanzierungsdefizit von 79,0 Milliarden Euro auswies. Auslaufende Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und der Energiekrise sorgten allerdings dafür, dass das Minus um 45,3 Milliarden Euro kleiner ausfiel als 2022. Rückläufige Transfers des Bundes bei gleichzeitig anhaltenden finanziellen Belastungen zur Versorgung von Schutzsuchenden trugen dazu bei, dass im vergangenen Jahr auch die Länder (6,4 Milliarden Euro) und Gemeinden (12,1 Milliarden Euro) rote Zahlen schrieben. 2022 hatten sie noch Überschüsse erzielt. Die Sozialversicherungen (10,0 Milliarden Euro) verzeichneten 2023 einen leichten Anstieg ihres Finanzierungsüberschusses.
Für dieses Jahr rechnen die meisten Experten mit einer weiter sinkenden Neuverschuldung, auch wegen der Sparmaßnahmen des Bundes nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Schuldenbremse. Die hohen Preise und Lohnabschlüsse dürften zudem die Steuereinnahmen steigen lassen.
(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)