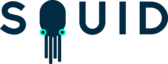Berlin (Reuters) – Der Expertenrat für Klimafragen hält trotz Fortschritten das deutsche Klimaziel 2030 ohne zusätzliche Instrumente für kaum zu schaffen.
Ein Rats-Gutachten komme zum Ergebnis “dass das Erreichen der Ziele des Klimaschutzgesetzes ohne wesentliche Anpassungen in der Ausrichtung eher fraglich erscheint”, sagte der Vorsitzende Hans-Martin Henning am Mittwoch in Berlin. Zwar habe sich der Rückgang des CO2-Ausstoßes beschleunigt und die Jahresziele wurden erreicht. Allerdings müsste das Tempo für das 2030-Ziel um 50 Prozent zulegen. Gebäude- und Verkehrssektor blieben problematisch. Wälder und Moore würden derzeit zudem unterm Strich CO2 produzieren, obwohl sie laut Planungen eigentlich zum Klimaschutz beitragen sollten. Der Rat machte zudem deutlich, für den klimafreundlichen Umbau seien jährlich Mehrinvestitionen zwischen 51 und 150 Milliarden Euro nötig.
Das unabhängige fünfköpfige Gremium muss laut Klimaschutzgesetz in regelmäßigen Abständen überprüfen, ob Deutschland sein völkerrechtlich verbindliches Ziel 2030 einhalten kann. Dies sieht eine Emissionsminderung gegenüber 1990 von 65 Prozent vor. Bereits im vergangenen Jahr wurde dies ohne Nachbesserungen als kaum erreichbar bezeichnet. Wird dies zwei Jahre in Folge attestiert, muss die Regierung nachsteuern. Der nächste Bericht dieser Art wäre erst nach der vorgezogenen Bundestagswahl fällig. Allerdings sieht das Klimagesetz ohnehin vor, dass jede neue Regierung innerhalb eines Jahres nach Antritt ein aktualisiertes Klimaschutzprogramm vorlegen muss.
Das jetzt vorliegende Zwei-Jahres-Gutachten hat in erster Linie die Aufgabe, die Wirkung bisheriger Entwicklungen und Instrumente zu überprüfen und auch Wirtschaftlichkeit und soziale Folgen unter die Lupe zu nehmen.
Die Experten erkennen an, dass es zuletzt Fortschritte gegeben hat: “Der Trend des Rückgangs der Treibhausgasemissionen von 2014 bis 2023 hat sich im Vergleich zur Dekade 2010 bis 2019 beschleunigt.” Dies gelte vor allem für den Energiesektor und teils auch für die Industrie. Bei letzterer wirkten aber die Energiekrise und die Wirtschaftsflaute. “Allerdings zeigt der vertiefte Blick dann auch, dass das Instrumentarium, also die Struktur der Maßnahmen, sich letztlich wenig geändert hat”, bemängelte Henning. Neue Instrumente seien aber nötig, um die Beschleunigung des Rückgangs zu verstärken.
Klimaminister Robert Habeck (Grüne) sagte, Deutschland sei in die richtige Richtung unterwegs: “Wir müssen Kurs halten.” Er teile zudem die Auffassung des Rats zur nötigen Ausweitung der Investitionstätigkeit. “Gleichzeitig können diese Investitionen wichtige Modernisierungsimpulse für die Wirtschaft geben.”
Umweltgruppen warnten dagegen vor einem Irrweg: “Laut diesem Gutachten müssen die Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor fünf Mal schneller als im Durchschnitt der letzten zehn Jahre gesenkt werden, um die Klimaziele im Jahr 2030 einzuhalten”, erklärte die Deutsche Umwelthilfe (DUH).
MILLIARDENZAHLUNGEN DROHEN WEGEN VERKEHR UND GEBÄUDEN
Auch der Expertenrat hatte die Sektoren Verkehr und Gebäude als problematisch eingestuft: Es würden zu viele Verbrenner-Autos zugelassen, die auch in vielen Jahren noch auf der Straße sein würden. Die Wirkungen des Deutschlandtickets im Nahverkehr seien schwer zu beziffern. Zudem würden in Deutschland zu wenig Wärmepumpen eingebaut, sodass auch hier fossile Energie eine zu große Rolle einnehme. Die CO2-Abgabe auf Gas, Heizöl oder Sprit, die in den nächsten Jahren steigen wird, könne allein nicht ausreichend sein, schreiben die Experten.
Dem widersprach FDP-Vizefraktionschef Lukas Köhler. Schon die Erfolge im Energiesektor seien auf den Handel mit CO2-Verschmutzungsrechten zurückzuführen. Dies könne ab 2027 mit dem erweiterten Handel bei Verkehr und Gebäuden ebenfalls funktionieren. Zudem müsse die unterirdische Speicherung von CO2 erlaubt werden. Das Gesetz von Habeck liege im Bundestag, die FDP würde zustimmen, sagte Köhler. Bei SPD und Grünen gibt es aber Widerstand im Bundestag.
Mit Blick auf die nötigen Kosten für den Umbau hin zur Klimaneutralität zogen die Experten 13 verschiedene Studien zu Rate. Diese sähen einen jährlichen Bedarf von privaten und öffentlichen Investitionen von 135 bis 255 Milliarden Euro. Allerdings müsse man davon die Kosten abziehen, die ohnehin für Ersatzbeschaffungen angefallen wären – etwa der Ersatz einer alten Heizung. An Mehrinvestitionen sei daher mit 51 bis 150 Milliarden Euro jährlich zu rechnen, sagte Ratsmitglied Thomas Heimer.
(Bericht von: Markus Wacket; redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)