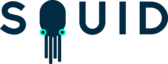Frankfurt (Reuters) – Die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) beraten in Frankfurt auf ihrer ersten Geldpolitik-Sitzung nach der Sommerpause über die Leitzinsen.
Volkswirte gehen davon aus, dass die EZB wie schon im Juli erneut ihre Füße still halten wird. Sie erwarten, dass Notenbankchefin Christine Lagarde und ihre Mitstreiter den Einlagesatz – das ist der Leitzins im Euroraum – bei 2,0 Prozent belassen werden. Diesen Satz erhalten Finanzinstitute, wenn sie bei der Notenbank Geld parken. Die Inflation in der 20-Länder-Gemeinschaft lag zuletzt im August mit 2,1 Prozent nur einen Tick über den von Lagarde & Co für die Euro-Zone angestrebten 2,0 Prozent Teuerung. Zudem sind die Folgen der Trump-Zölle für Inflation und Konjunktur in der Währungsunion noch nicht absehbar. All das spricht für eine abwartende Haltung der Währungshüter.
Den Euro-Wächtern liegen bei ihren Beratungen diesmal auch neue Wirtschaftsprognosen der Notenbank-Volkswirte zu Inflation und Wachstum vor. Diese Projektionen dürften den Ökonomen zufolge zeigen, dass die Inflation mittelfristig in der Spur bleibt und die Wachstumserwartungen vielleicht einen Tick besser ausfallen werden.
Die EZB will ihren Zinsbeschluss am Nachmittag um 14.15 Uhr veröffentlichen. Im Anschluss daran steht Lagarde ab 14.45 Uhr den Journalisten Rede und Antwort. Dabei dürfte die zentrale Frage sein, wie die EZB-Chefin den weiteren Zinspfad einschätzt und ob es überhaupt noch in diesem Jahr zu einer weiteren Zinssenkung kommen wird. Zuletzt hatte Lagarde davon gesprochen, dass die EZB sich in einer ‘guten Position’ befinde. Am Finanzmarkt wird mehrheitlich aktuell kein weiterer Schritt nach unten mehr für dieses Jahr erwartet.
Darüber hinaus dürfte die politisch fragile Lage in Frankreich Thema sein. Die Renditeaufschläge (Spreads) für französische Staatsanleihen im Vergleich zu ihren deutschen Gegenstücken waren zuletzt wieder kräftig angestiegen. Experten erwarten, dass Lagarde anmahnen wird, dass die Länder der Eurozone ihre Bemühungen zur Konsolidierung der Haushalte verstärken müssen. Sie dürfte aber auch zu einem möglichen Einsatz des Kriseninstruments TPI befragt werden, das den Währungshütern erlaubt, in finanzielle Bedrängnis geratene Länder mit Staatsanleihekäufen unter die Arme zu greifen.
(Bericht von Frank Siebelt, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)